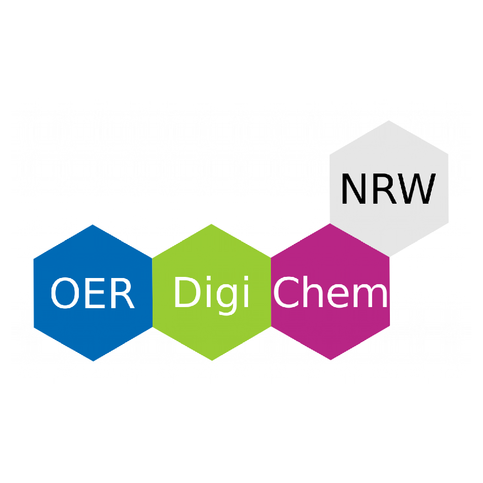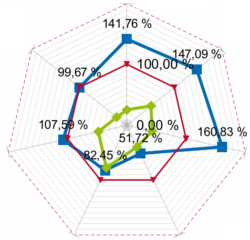OER.Digichem.nrw: Digitale Kompetenzen in der Chemieausbildung fördern Das Projekt OER.DigiChem.NRW ist ein gemeinsames Projekt der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, der Bergischen Universität Wuppertal und der Technischen Hochschule Köln. Es wird im Rahmen der Landesinitiative OER.Content.nrw vom 1.10.2020 bis zum 31.12.2022 durch das Land Nordrhein-Westfalen gefördert. OER.Digichem.nrw Die heutige Generation Studierender wird häufig als „Digital Natives“ bezeichnet. In […]